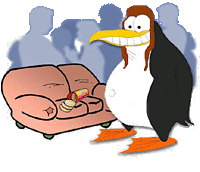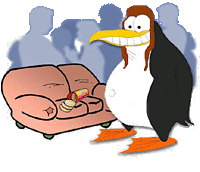Wenn der Staat Unschuldige opfert
Von Prof. Reinhard Merkel (16.07.2004)
Das neue Luftsicherungsgesetz erlaubt, entführte Flugzeuge abzuschießen, die das Leben von Menschen am Boden bedrohen. Das ist ein singulärer Tabubruch.
Am 18. Juni hat der Bundestag ein Gesetz verabschiedet, das einen beispiellosen Tabubruch im rechtlichen Fundament der Gesellschaft normiert. Um sein Gewicht zu ermessen, muss man ihn nur ein wenig deutlicher formulieren, als es das Gesetz tut. Paragraf 14 Absatz 3 des neuen Luftsicherungsgesetzes erlaubt dem Staat die gezielte, vorsätzliche und massenhafte Tötung unschuldiger Bürger, um viele andere unschuldige Bürger aus einer Lebensgefahr zu retten. Ein entführtes und mit Passagieren gegebenenfalls voll besetztes Flugzeug darf auf Befehl des Verteidigungsministers abgeschossen werden, wenn es als Waffe gegen das Leben anderer Menschen eingesetzt zu werden droht.
Über die Reichweite von Grundrechten kann man lange streiten. Zum unbestrittenen Kernbestand ihres Sinnes gehört es jedoch, die Zulässigkeit solcher lebensverrechnenden Kalküle kategorisch auszuschließen. Niemand, der ein Grundrecht auf Leben hat, muss dieses Leben zugunsten anderer, denen er nichts getan hat und nichts tun will, die er nicht bedroht, ja nicht einmal kennt, opfern lassen. Das außer Zweifel zu stellen gehört zu den schlechthin primären Funktionen des Lebensrechts. Gestattet sich der Staat nun unter bestimmten Bedingungen selbst eine solche Opferung von Menschenleben zugunsten Dritter, so exkludiert er die Betroffenen im Anwendungsfall aus der Sphäre des Rechts. Er entzieht ihnen den Status als Inhaber von Grundrechten.
Gleichwohl mag Paragraf 14 Absatz 3 des Luftsicherungsgesetzes am Ende legitimierbar sein. Die Einsichten allerdings, die der Versuch einer solchen Begründung, und die Zumutungen, die sie selbst uns allen aufzwingt, führen hart an die Grenze des Erträglichen. Vor diesem Hintergrund erscheint der Umstand, dass die neue Regelung im weiten Raum der öffentlichen Meinung ohne jedes Echo geblieben ist, in Kommentaren und Leitartikeln nicht die leiseste Irritation ausgelöst hat, nachgerade unglaublich.
Das Katastrophen-Szenario, das dem Gesetzgeber vorschwebte, ist offensichtlich. Der 11. September 2001 hat ihm seine nicht mehr erläuterungsbedürftige Anschaulichkeit gegeben. Um als legislative Antwort darauf vollständig plausibel zu sein, ist Paragraf 14 Absatz 3 Luftsicherungsgesetz jedenfalls zu weit und zu ungenau geraten; doch solche Fehler lassen sich leicht beheben. Worum es aber vor allem geht, das ist die quälende Vorstellung des von Terroristen entführten Passagierflugzeugs, das auf ein Großstadtzentrum oder ein Atomkraftwerk zurast. Sie hat das Gesetz motiviert und ist primärer Gegenstand seiner Regelung. Niemand wird dem Gesetzgeber die beklemmende Schwierigkeit des Problems bestreiten.
Ohne weiteres legitimierbar ist die Tötung der Terroristen selbst. Sie greifen gegenwärtig und rechtswidrig das Leben anderer Menschen an. Nach dem fundamentalen Rechtsprinzip aller Zeiten und Kulturen sind sie daher legitimes Ziel einer tödlichen Notwehr, wenn man will: eines überdimensionalen »finalen Rettungsschusses«. Als Nothilfe ist er auch Dritten erlaubt und damit dem Staat auf der Grundlage eines förmlichen Gesetzes erst recht.
Die Passagiere in der Maschine freilich greifen niemanden an. Im Verhältnis zu ihnen gibt es nichts »abzuwehren«. Das Notwehrrecht deckt ihre Tötung daher selbst dann nicht, wenn diese mit der rechtmäßigen Abwehrhandlung gegen die Verbrecher, dem Abschuss, zwingend verbunden ist. Wer einen Angriff abwehrt, indem er Rechts- und Lebensgüter unbeteiligter Dritter zerstört, verteidigt diesen gegenüber nicht etwa die eigene, sondern greift in deren rechtliche Schutzsphäre über.
Auch dazu mag er berechtigt sein. Die Notwehr ist nicht das einzige Notrecht, das wir kennen und anerkennen. Unabhängig davon, wer sie angreift, befinden sich die Menschen am bedrohten Zielort der entführten Maschine objektiv in einer tödlichen Gefahr, einem existenziellen Notstand. Auch er vermag Eingriffe in fremde Rechtssphären zu rechtfertigen – allerdings nur in sehr engen Grenzen. Denn es liegt auf der Hand, dass der Übergriff in Schutzgüter Unbeteiligter zur Abwendung eigener Not nicht auf dem Prinzip der berechtigten Selbstverteidigung gründet, sondern auf dem ganz anderen und wesentlich schwächeren der mitmenschlichen Solidarität. Solche Pflichten sind genuin ethischer Provenienz. Zu Rechtspflichten erweitert, werden sie erzwingbar. Den liberalen Vätern unseres heutigen Strafgesetzbuchs aus dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts erschienen solche Rechtspflichten noch gänzlich indiskutabel. Aber selbstverständlich darf auch heute der auf Grundrechten beruhende Verfassungsstaat eine Aufopferungspflicht aus zwangsrechtlicher Solidarität allenfalls für bagatellhafte oder ersetzbare Güter gebieten. Und nur solche Eingriffe darf er daher dem im Notstand Handelnden erlauben.
Niemals kann zu diesen Gütern das Leben gehören. Es ist ausgeschlossen, rechtmäßig unbeteiligte Dritte zu töten, um das eigene oder das Leben anderer, und wären es Millionen, zu retten. Niemand kann rechtlich verpflichtet sein, aus Solidarität das eigene Leben für noch so viele andere herzugeben, die er nicht bedroht. Dass es ihm auch der Staat nicht aus Gründen einer solidarischen Pflicht nehmen darf: das eben stellen die Grundrechte klar. »His life is the only one he has«, schreibt der amerikanische Philosoph Robert Nozick. Wer das Leben seines schwer verletzten Kindes nur dadurch retten kann, dass er gegen den Willen seines Nachbarn dessen Pkw nimmt (Eingriff in Freiheit und Eigentum) und damit unter Verletzung zahlreicher Verkehrsvorschriften (Eingriff in die Sicherheit des Straßenverkehrs) das Kind zur nächsten Klinik fährt, der darf für solche Übergriffe von den Betroffenen eine solidarische Hinnahme verlangen. Undenkbar ist es aber, ihn auch dann zu rechtfertigen, wenn er in der Klinik das dort am einzigen verfügbaren Respirator hängende fremde Kind mit tödlicher Wirkung abhängt, um das eigene anzuschließen, weil es nur so zu retten ist. Und in anderen Situationen mag die Zahl der zu Rettenden so groß sein, wie man will – das ändert nichts. Gegen das Grundrecht auf Leben zählen Zahlen nicht. Käme etwa der Staat der erpresserischen Forderung von Terroristen nach, einen Unschuldigen vor laufenden Kameras öffentlich hinzurichten, weil sich nur so die angedrohte Zündung einer versteckten Atombombe in einer deutschen Großstadt verhindern lässt, so handelte er ohne Zweifel unrecht. Wer das nicht glauben mag, stelle sich vor, er selbst sei der Hinzurichtende. Grundrechte sind anti-utilitaristisch. Sie schützen den einzelnen, nicht den jeweils größten allgemeinen Nutzen.Wäre es anders, so wären sie keine Grundrechte.
Nun kennt das Recht neben dieser typischen Form des Notstandshandelns, das genau wegen seines Eingriffscharakters »aggressiv« heißt, auch den so genannten defensiven Notstand. Hier wird eine Gefahr nicht auf Kosten unbeteiligter Dritter abgewehrt, sondern gewissermaßen auf ihren Ursprung zurückgewälzt. Auch wer kein Angreifer im Sinne der Notwehr ist, mag von einem bösen Schicksal zur Gefahrenquelle für andere gemacht worden sein. Die Autofahrerin, die wegen eines plötzlichen Schlaganfalls bewusstlos wird und deren Wagen nun führungslos auf einen belebten Markt zusteuert, darf von dem geistesgegenwärtigen Kranführer durch das Fallenlassen schwerer Betonplatten vor, ja auf den Wagen mit möglicherweise tödlicher Wirkung gestoppt werden. Defensivnotstandshandlungen gegen das Leben eines (schuldlosen!) Gefahrverursachers sind stets tragic choices. Aber es ist ein Gebot der Fairness, also der Gerechtigkeit, mit der tragischen Beseitigung der Gefahr den zu belasten, den das Schicksal zu deren Ursprung gemacht hat. Daher reichen die Befugnisse im Defensivnotstand weit über die des Aggressivnotstands hinaus und nähern sich denen der Notwehr.
Ist das die Lösung? Entspricht dies nicht dem Katastrophenszenarium des entführten und dann abgeschossenen Flugzeugs? Sind dessen Passagiere nicht von einem finsteren Schicksal ganz buchstäblich ins Innere einer tödlichen Gefahrenquelle gelockt und damit selbst zum Bestandteil dieser Gefahrenquelle, der zum Geschoss verwandelten Maschine, gemacht worden? Werden sie daher nicht nach Defensivnotstandsprinzipien zusammen mit dem gesamten Gefahrenobjekt auf zwar tragische Weise, aber rechtmäßig beseitigt?
Nein. So kann man sich Legitimationstitel aus fundamentalen Prinzipien nicht erschleichen, ohne diese selbst zu desavouieren. Es wäre nachgerade arglistig, den Passagieren der entführten Maschine zu sagen, sie seien leider eine Gefahrenquelle für das Leben anderer geworden und würden deshalb rechtens getötet. Denn das sind sie nicht geworden. Der Umstand, dass sie schuldlos im Bauch einer Gefahrenquelle stecken, macht sie nicht selbst zu einer. Legt eine schwangere Frau mit der Pistole auf ihren Liebhaber an, um ihn zu töten, so ist es abwegig, auch den Embryo in ihrem Uterus zur Gefahrenquelle für den Bedrohten zu erklären. Tötet dieser in rechtmäßiger Notwehr die Frau, so tötet er das Ungeborene gleichwohl ohne Rechtfertigung. Gewiss entschuldigt ihn das Strafrecht dafür und bestraft ihn nicht. Aber es erkennt diesen Teil seiner Tat nicht als objektiv rechtmäßig an.
Auch die Figur einer solchen Entschuldigung wurde im Vorfeld des Flugsicherungsgesetzes bemüht. Es handle sich, sagte der Geschäftsführer der Grünen-Fraktion, Volker Beck, um einen Fall des »übergesetzlichen entschuldigenden Notstands«, und das mache die Regelung zulässig. Das ist ein törichter Satz. »Übergesetzlich« nur entschuldigte Handlungen sind rechtswidrig, also unerlaubt. Sind sie dies (wie hier) aus fundamentalen rechtsprinzipiellen Gründen, so kann der Staat sie sich nicht selbst per Gesetz erlauben, ohne das einschlägige Grundrecht zu beseitigen. Und damit schließt sich der Kreis: Tötet der Staat in einer solchen Gefahrenlage die Passagiere rechtens, so entzieht er ihnen vorher notwendig das Grundrecht auf Leben.
Nicht weniger töricht als Becks Behauptung wäre der wohlfeile Verweis auf den »Gesetzesvorbehalt«, mit dem Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz das Lebensrecht ausdrücklich einer Beschränkbarkeit durch einfache Gesetze unterwirft. Denn die »Beschränkung« im Luftsicherungsgesetz ist keine; sie ist, wie wir gesehen haben, ein vollständiger Entzug des Grundrechts. Damit verletzt sie zugleich das Gleichbehandlungsgebot des Artikels 3 und genau deshalb wohl auch die Menschenwürde, die vor allem den fundamentalen Status als gleiche Rechtsperson, als Grundrechtsträger garantiert. Man erwäge das an der Vorstellung einer Norm, die unter Berufung auf den Gesetzesvorbehalt die vorzeitige aktive Tötung unrettbar verlorener Unfallopfer erlaubte, wenn nur mit deren Organen das Leben anderer Menschen gerettet werden kann. Ausgeschlossen, dass ein solches Gesetz in Karlsruhe Bestand hätte.
Soll das Luftsicherungsgesetz überhaupt legitimierbar sein, dann nur, wenn der Staat seinen Bürgern und diese sich selbst klar machen, was es in Wahrheit bedeutet. Es geht nicht einfach um das Leben der Passagiere. Es geht um den Bruch einer Grundnorm der Rechtsordnung. Es geht, noch einmal, um die Exklusion »Unschuldiger« aus dem Recht. Die amtliche Begründung für Paragraf 14 Absatz 3 des Luftsicherungsgesetzes umfasst genau zwölf Zeilen. Das hier erörterte Problem berührt sie mit keinem Wort; von Begründung keine Spur. Kein Wort auch zu Artikel 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention, der jede staatlich veranlasste »absichtliche Tötung« jenseits von Notwehr, Todesstrafe, Bürgerkriegszuständen und Fluchtvereitelung nach Festnahmen verbietet.
Wie könnte eine wirkliche Begründung aussehen? Der erste Schritt des Arguments muss der Hinweis auf die Asymmetrie der Rettungschancen sein. Die Passagiere des Flugzeugs sind nach menschlichem Ermessen in jedem Fall verloren: Entweder stürzen sie mit der Maschine ins Ziel der Terroristen, oder sie werden abgeschossen. Gerettet werden können jedoch die bedrohten anderen am Zielort des Anschlags. Wohl verlangt der Staat von den Passagieren die Aufopferung ihres Lebens, aber nicht die einer zeitlich offenen Zukunft, sondern die ihrer wenigen letzten Minuten. Und das mag man jedenfalls ethisch vom Gebot zur Solidarität beglaubigt sein lassen.
Eine solche Wertung steht ersichtlich auf dem schwankenden Grund einer doppelt unsicheren Prognose: »Nach menschlichem Ermessen verloren sein« müssen jedenfalls die Passagiere der entführten Maschine. Dasselbe muss sich aber auch von den Menschen am Zielort des Anschlags sagen lassen – sofern der Abschuss unterbliebe. Denn allenfalls dann, nämlich als Rettungshandlung, wäre dieser zu rechtfertigen. Beide Prognosen sind als Gewissheiten nicht zu haben. Sind sie es dann als moralische und juristische Rechtfertigung einer gezielten sofortigen Tötung? Die Maschine, die am 11. September 2001 in Pennsylvania abstürzte, befand sich, so hieß es später, bereits im Fadenkreuz eines amerikanischen Jagdbombers. Abgeschossen wurde sie nicht. Gleichwohl hat sie das ihr »nach menschlichem Ermessen« zugedachte Terrorziel nicht erreicht, niemanden außer ihren Insassen getötet.
Dass Handlungen zur Gefahrenabwehr stets belastet sind mit prognostischer Unsicherheit, macht sie dennoch nicht unzulässig. Das verbleibende Risiko eines Irrtums ist rechtlich wie ethisch erlaubt, selbst wenn es nachträglich zur Gewissheit würde. Für einen so beispiellosen Vorgang wie die massenhafte Tötung Unschuldiger durch den Staat wird man aber das absolut erreichbare Maximum an Sicherheit als absolut notwendiges Minimum jeder denkbaren Rechtfertigung verlangen müssen. Die Rechtssprache hat genügend Möglichkeiten, den unbedingten Ultima-Ratio-Charakter einer solchen Entscheidung deutlich zu fixieren. Das Luftsicherheitsgesetz versagt hier auf schwer begreifliche Weise. Den Abschussbefehl geben darf der Verteidigungsminister schon dann, »wenn nach den Umständen davon auszugehen ist, dass das Luftfahrzeug gegen das Leben von Menschen eingesetzt werden soll«. Der Eindruck ist schwer abzuweisen, dass eine so nebelhafte Formel weniger dem Schutz des Lebens der Passagiere als dem des Verteidigungsministers vor nachträglichen rechtlichen Ermittlungen dienen soll.
Aber selbst wenn jene Asymmetrie der Rettungschancen zwischen den Passagieren der Maschine und den am Zielort des Anschlags Bedrohten mit wirklich menschenmöglicher Sicherheit feststeht, reicht sie allein nicht für eine rechtliche Legitimation. Man erinnere sich an das Beispiel des unrettbar verlorenen Unfallopfers, das zur lebensrettenden Organspende vorzeitig getötet werden soll. Auch die vielleicht erheblich größere Zahl der Geretteten kann es nicht sein, was die gezielte Tötung der wenigen allenfalls rechtmäßig machte. Man denke an den zur Verhinderung einer atomaren Katastrophe öffentlich hingerichteten Unschuldigen. Es muss etwas hinzukommen, was die spezifische Aufgabe des Staates als Garant des öffentlichen Friedens, also der Rechtsordnung als ganzer berührt. Terroristische Anschläge wie die des 11. September zielen nicht primär auf die getöteten Opfer. Sie zielen auf das Herz des Staates: auf seine Rolle als Inhaber des Gewaltmonopols, das ihn zur Garantie der rechtlichen Friedensordnung erst befähigt. Diese Fähigkeit ist eine notwendige Bedingung seiner Legitimität. Nur soweit er die Schutzfunktion seiner Normen hinreichend gewährleisten kann, kann er für diese und vor ihnen Gehorsam verlangen. Anschläge, die diese Fähigkeit des Staates prinzipiell in Zweifel zu ziehen geeignet sind, bedrohen daher die normativen Fundamente seiner Existenz. Und nur insofern mag die möglicherweise große Zahl der Geretteten einen Beitrag zur Legitimation des tödlichen Abschusses liefern: Anschläge auf Einzelpersonen dürften eine vergleichbare symbolische Wucht der Desavouierung staatlicher Rechtsmacht nicht entfalten können.
Dasselbe gilt übrigens für Flugzeugentführungen durch »einfach« kriminelle oder schlicht psychopathische Täter. Solche Fälle erfasst das Gesetz in seiner gegenwärtigen Grobheit umstandslos mit. Das ist schwerlich akzeptabel. Hat ein Anschlag keinen terroristischen Ursprung, so zielt er im hier skizzierten Sinn nicht auf das Herz, die Legitimität des Staates. Dann aber darf dieser die grundrechtlichen Schranken seiner Befugnisse nicht verlassen, nicht zum Totschläger seiner rechtstreuen Bürger werden, um andere Bürger zu retten. Ein Terrorismus-Vorbehalt, der dies klarstellte, wäre unschwer in den Wortlaut des Gesetzes einzufügen.
Das alles legt eine beklemmende Einsicht nahe. Wenn die Garantiefunktion des Staates für den Bestand der gesamten Normenordnung bedroht ist, dann mag seine Verpflichtung auf die internen Maximen dieser Ordnung im Extremfall ihren Sinn verlieren. Das ist es, was der Begriff einer Exklusion aus den Grundrechten bezeichnet, und anders wird sich die Konsequenz des Gesetzes schwerlich bezeichnen lassen. So sind offenbar die Zeiten und die Bedrohungen geworden – und dies ist vielleicht die kälteste Botschaft des Luftsicherungsgesetzes: dass sie staatliche Befugnisse erforderlich oder jedenfalls wirklich machen, für die es innerhalb der Prinzipien des Rechts keinen Ort, keinen Namen und keine Deckung mehr gibt. Wer eine solche Begründung verwirft, muss auch das Gesetz verwerfen, das anders nicht begründbar ist. Wer aber dieses akzeptiert, sollte wissen, was es bedeutet.
Der englische Rechtsphilosoph Herbert Hart schrieb vor beinahe fünfzig Jahren, man müsse die Fälle, in denen das Leben uns zwingt, von zwei Übeln das geringere zu wählen, »anfassen wie Brennnesseln: mit dem Bewusstsein dessen, was man tut«. Dass im Fall des Luftsicherungsgesetzes beim Gesetzgeber wie in der Öffentlichkeit ein solches Bewusstsein vorhanden wäre, ist nicht zu erkennen.
Reinhard Merkel
(Mit freundlicher Genehmigung des Autors - Quelle: DIE ZEIT 08.07.2004 Nr.29)
|